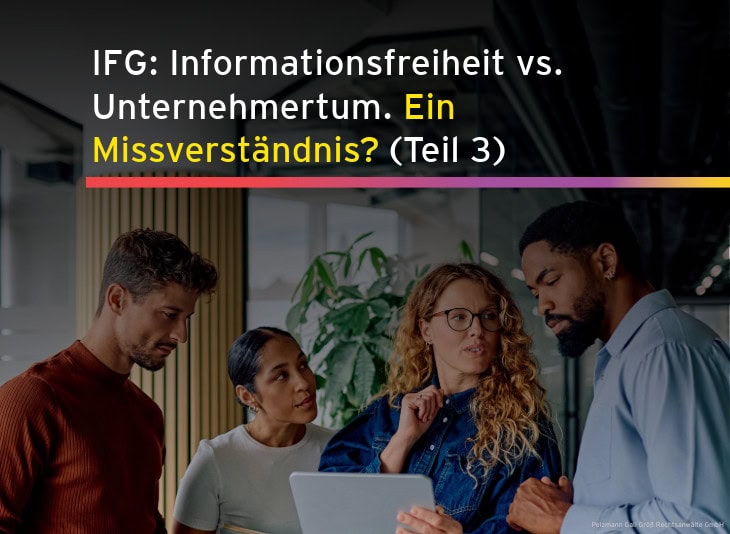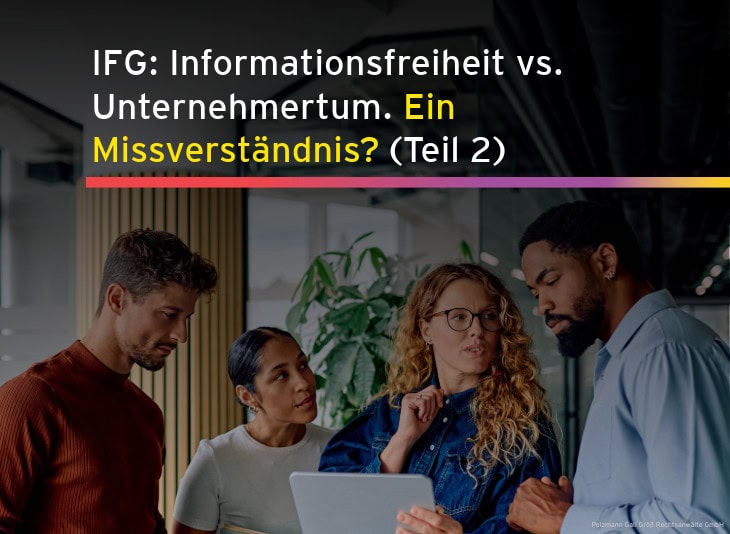Am 10. Mai 2023 wurde die EU-Richtlinie 2023/970 erlassen (kurz „Lohntransparenz-RL“ oder „Richtlinie“), die bis spätestens 7. Juni 2026 in nationales Recht umzusetzen ist. Die EU-Lohntransparenz-Richtlinie zielt darauf ab, Lohngleichheit und Transparenz in der Bezahlung zu fördern. Dadurch soll der Gender Pay Gap, der die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen beschreibt, überwunden werden. Im Jahr 2023 lag der Gender Pay Gap in Österreich bei 18,3 Prozent und ist damit im EU-Vergleich sehr hoch. Doch was bedeutet die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie nun konkret für österreichische Unternehmen?
Die Lohntransparenz-RL soll mithilfe einer Reihe verbindlicher Maßnahmen Beschäftigte in die Lage versetzen, ihr Recht auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden einerseits Dienstgebenden diverse Pflichten auferlegt und andererseits den betroffenen Beschäftigten die Rechtsdurchsetzung erleichtert.
Pflichten der Dienstgebenden
Auskunftspflicht gegenüber Beschäftigten und Stellenbewerber:innen
Gemäß Art. 7 der Lohntransparenz-RL sind Dienstgebende — unabhängig von der Unternehmensgröße/Beschäftigtenzahl — verpflichtet, ihren Beschäftigten auf deren Verlangen schriftlich Auskunft über die individuelle und durchschnittliche Entgelthöhe zu geben, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und für jene Gruppe von Beschäftigten, die gleiche oder gleichwertige Arbeit wie sie verrichten. Dies bedeutet, dass Dienstgebende nicht nur die Gehälter offenlegen, sondern auch (sachlich) erklären müssen, warum etwaige Unterschiede bestehen. Die Auskunft muss binnen zwei Monaten ab Auskunftsbegehren erteilt werden. Über dieses individuelle Informationsrecht müssen Dienstgebende nach dem Wortlaut der Richtlinie ihre Beschäftigten auch jährlich informieren.
Eine Auskunftspflicht besteht auch gegenüber Stellenbewerber:innen. Diese müssen vor Antritt der Beschäftigung über das Einstiegsgehalt bzw. dessen Spanne und gegebenenfalls über einschlägige Kollektivvertragsbestimmungen informiert werden (Art. 5 der Richtlinie). Diese Informationen müssen so bereitgestellt werden, dass fundierte und transparente Verhandlungen über das Entgelt gewährleistet werden. Die Richtlinie verweist in diesem Zusammenhang beispielsweise auf Stellenausschreibungen oder auf eine Information noch vor dem Vorstellungsgespräch. Das bedeutet, dass zukünftig bei den Stellenausschreibungen die bloße Angabe der relevanten Mindesteinstiegsgehälter nicht mehr ausreichen wird. Nach dem Wortlaut der Richtlinie muss zukünftig das tatsächlich zu erzielende Gehalt bzw. eine Spanne angegeben werden, sofern das Einstiegsgehalt nicht bereits fixiert ist. Dienstgebenden ist es zudem untersagt, Stellenbewerber:innen nach ihrer Entgeltentwicklung in ihren laufenden oder früheren Beschäftigungsverhältnissen zu fragen.
„Zukünftig trifft die Berichtspflicht bereits
Unternehmen ab 100 und mehr Beschäftigten.
Für Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten
besteht nach der Lohntransparenz-RL
keine Berichtspflicht, allerdings kann
die nationale Umsetzung Berichtspflichten auch
für solche Unternehmen vorsehen.“Mag. Christina Schrott
Rechtsanwältin für Arbeitsrecht in Salzburg
Um die Auskunftspflichten erfüllen zu können, werden Dienstgebende über ein im Detail festgelegtes Vergütungssystem verfügen müssen, das einheitlichen, objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien folgt und mit dem sich sowohl Einstiegsgehälter als auch Entgeltentwicklungen erklären lassen. Dies lässt sich bereits aus Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie ableiten, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass „Arbeitgeber über Vergütungsstrukturen verfügen, durch die gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gewährleistet wird“.
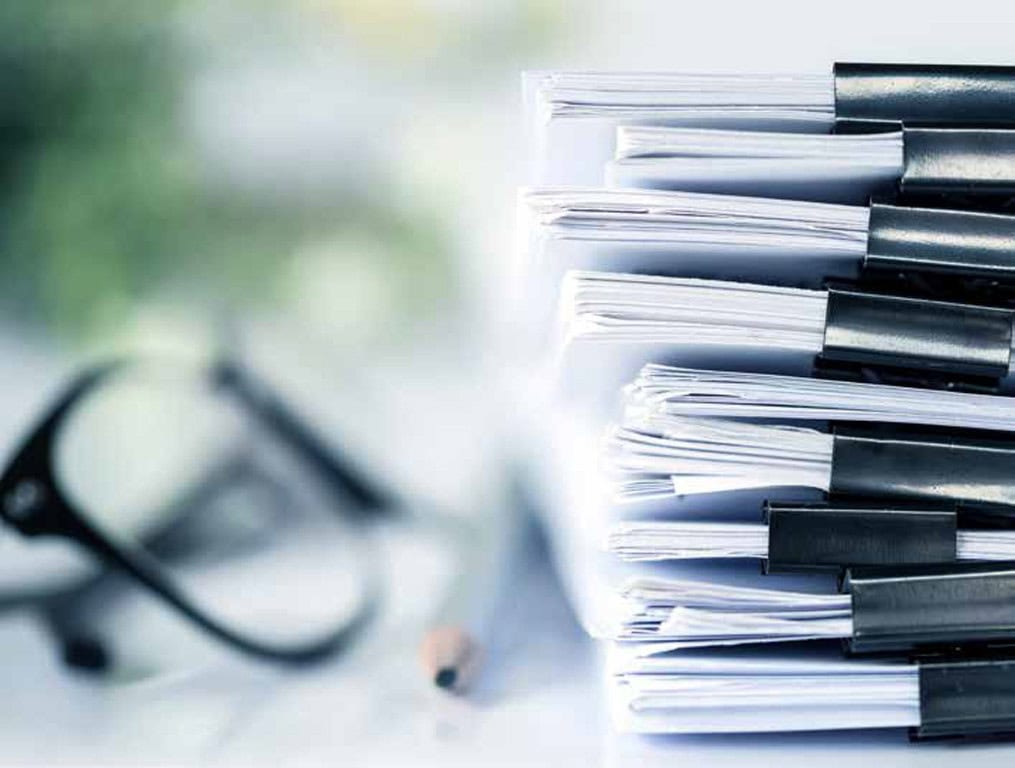
In Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie heißt es weiter, dass Entgeltstrukturen so beschaffen sein müssen, „dass anhand objektiver, geschlechtsneutraler und mit den Arbeitnehmervertretern vereinbarter Kriterien, sofern es solche Vertreter gibt, beurteilt werden kann, ob sich die Arbeitnehmer im Hinblick auf den Wert der Arbeit in einer vergleichbaren Situation befinden. Diese Kriterien dürfen weder in unmittelbarem noch in mittelbarem Zusammenhang mit dem Geschlecht der Arbeitnehmer stehen. Sie umfassen Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen und gegebenenfalls etwaige weitere Faktoren, die für den konkreten Arbeitsplatz oder die konkrete Position relevant sind.“
Berichtspflichten
Die Berichtspflichten stellen eine wesentliche Kernbestimmung der Lohntransparenz-RL dar. Bereits bisher sah das österreichische Recht eine vergleichbare Bestimmung in Form des Einkommensberichts gem. § 11a Gleichbehandlungs-gesetz (GlBG) vor, wonach Dienstgebende zur Erstellung eines solchen verpflichtet sind, wenn sie dauernd mehr als 150 Beschäftigte haben. Die bisherige Regelung ist allerdings sowohl hinsichtlich der Beschäftigtenzahl als auch inhaltlich nicht so weitreichend wie die neuen Vorgaben der Lohntransparenz-RL.
Zukünftig trifft die Berichtspflicht bereits Unternehmen ab 100 und mehr Beschäftigten. Für Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten besteht nach der Lohntransparenz-RL keine Berichtspflicht, allerdings kann die nationale Umsetzung Berichtspflichten auch für solche Unternehmen vorsehen.
Von der Berichtspflicht sind folgende Informationen umfasst:
- das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle
- das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle bei ergänzenden oder variablen Bestandteilen
- das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle
- das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle bei ergänzenden oder variablen Bestandteilen
- der Anteil der Beschäftigten, die ergänzende oder variable Entgeltbestandteile erhalten
- der Anteil der Beschäftigten in jedem Entgeltquartil
- das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle zwischen Beschäftigten bei Gruppen von Beschäftigten aufgeschlüsselt nach dem normalen Grundlohn oder -gehalt sowie nach ergänzenden oder variablen Entgeltbestandteilen
Die Lohntransparenz-RL umfasst inhaltlich damit wesentlich mehr Punkte bzw. Informationen, als derzeit im Rahmen des Einkommensberichts erforderlich sind.
Adressat dieser Informationen soll zukünftig außerdem primär eine von den Mitgliedstaaten zu benennende Überwachungsstelle sein. Welche Stelle dies sein wird, wird die nationale Umsetzung zeigen. Die erhaltenen Informationen sind — mit Ausnahme der Informationen zum geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle zwischen Beschäftigten bei Gruppen von Beschäftigten (z. B. Arbeiter:innen und Angestellte) — von dieser Stelle zu veröffentlichen, um einen Vergleich zwischen Dienstgebenden, Sektoren und Regionen zu ermöglichen.
Auch darin liegt ein wesentlicher Unterschied zur aktuellen Rechtslage, wonach alle Informationsberechtigten grundsätzlich eine Verschwiegenheitspflicht über den Inhalt des Einkommensberichts trifft, sofern keine der gesetzlich normierten Ausnahmen greift; eine solche Ausnahme wäre beispielsweise gegeben, wenn Inhalte des Einkommensberichts zum Zwecke der „Einholung von Rechtsauskünften oder Rechtsberatung durch Interessenvertretungen und sonstige Personen oder Einrichtungen, die ihrerseits einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen“ weitergegeben werden oder wenn dies im Rahmen der „Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung von Ansprüchen nach dem GlBG oder eines Verfahrens vor der Gleichbehandlungskommission“ geschieht.
Entgeltbewertung
Die Lohntransparenz-RL sieht zudem verpflichtend eine gemeinsame Entgeltbewertung vor, wenn
- sich aus der Berichterstattung geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede von 5 Prozent oder mehr ergeben,
- das dienstgebende Unternehmen keine Rechtfertigung durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien darstellen kann und
- das dienstgebende Unternehmen nicht binnen sechs Monaten nach der Berichterstattung den ungerechtfertigten Unterschied korrigiert hat.
Dienstgebende und Beschäftigtenvertreter:innen haben bei der gemeinsamen Entgeltbewertung die geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede zu analysieren und insbesondere deren Gründe zu erarbeiten. Weiters sollen Maßnahmen festgelegt werden, um geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede zu beseitigen, falls diese nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt sein sollten. Gab es in der Vergangenheit bereits solche Maßnahmen, soll deren Wirksamkeit evaluiert werden.
Leider regelt die Lohntransparenz-RL nicht, wie Maßnahmen zur Beseitigung der geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede aussehen können. Ungeregelt ist weiters auch, welche etwaigen Konsequenzen damit verbunden sind, falls sich Dienstgebende und Beschäftigtenvertreter:innen auf keine gemeinsame Entgeltbewertung einigen können. Diesbezüglich muss die nationale Umsetzung abgewartet werden.
Die gemeinsame Entgeltbewertung ist den Beschäftigten, den Beschäftigtenvertreter:innen sowie der einzurichtenden Überwachungsstelle zur Verfügung zu stellen.
Ausblick
Die Lohntransparenz-RL bringt einige Herausforderungen für Unternehmen in Österreich mit sich. In einem zweiten Teil, der im Herbst 2025 erscheinen wird, werden wir auf die zur Rechtsdurchsetzung vorgesehenen Maßnahmen der EU-Richtlinie eingehen. Hier werden wir auch To-dos aufzeigen, um für die anstehenden Veränderungen vorbereitet zu sein. Bleiben Sie gespannt auf weitere Einblicke und praxisnahe Empfehlungen, wir halten Sie am Laufenden.
Dieser Artikel zur EU-Lohntransparenz-RL ist im aktuellen EY Tax & Law Magazine erschienen, welches Sie hier als PDF lesen können:
Informieren Sie sich bei unseren Expert:innen für Arbeitsrecht
Wir beraten Unternehmen weltweit in komplexen arbeitsrechtlichen Fragestellungen.

Mag. Christina Schrott
Rechtsanwältin bei EY Law – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte in Salzburg | Arbeitsrecht
christina.schrott@eylaw.at
- Alle aktuellen Legal News von EY Law
- Rechtsberatung: Unser Beratungsangebot im Arbeitsrecht in Österreich
- Kontaktieren Sie unsere Experten in Wien, Salzburg und Linz!